Leseprobe:
Frühjahr 1989
Dünner Schnee grieselte durch die Luft. Im Februar hatte es schon Frühlingstage gegeben, Sonne und Schneeglöckchen sahen sich an, es war kurz vor Anbruch von etwas. Vielleicht weil der Schnee nicht weiß war und hoffnungslos einsank in den Straßenmatsch. Es war die Sonne, die länger blieb über Tag und die Nachmittage bis in den Abend sichtbar machte. Die Stadt roch deutlich nach Kohle und Schwefel. Der beendete graue Monat wurde jedes Jahr wieder durch die Tatsache der Ferien farbig. Die nächste Hoffnung waren die warmen Tage im Frühjahr. Bald würde der Geruch des Flusses dazu kommen, der als breites dunkles Geschenkband um die Stadt lag. Breit und flach war die Havel und sicher nicht sauber, an ihren Rändern flog Schaum.
Die Straßenbahnen und Busse waren das erste Mal nach drei Wochen wieder voll. Durch die Adern der öffentlichen Verkehrsmittel strömten die Angestellten, die Verkäufer, die Lehrer, die Schüler, stiegen an den Haltestellen aus, sahen die bekannten Läden, in der Straße zum Nauener Tor hin schoben Verkäuferinnen mit Schneeschiebern den grauen Matsch bis an den Rand des Bürgersteiges. Unterbrochene Deiche, niedrig und naß, säumten in Abständen die Gehwege. Das Tor selbst, breithüftig mit zwei Kegeltürmen, hatte die freundliche Farbe Ocker mit der Gemütlichkeit des nicht ganz Perfekten: Farbe und Putz fehlten an einigen Stellen. Nur die Straßenbahn fuhr etwas quietschend hindurch, Trabbis plepperten im Kreisverkehr drumherum, vervollständigt von brummenden Ladas, Wartburgs und einigen farblosen LKWs. Die bunt lackierten kamen aus Polen. Die Nachbarn im Osten konnten allem Möglichen noch eine attraktive Note geben. Der polnische Kosmetikladen am Beginn der Straße war immer voller Kunden.
Die Wolken würden bleiben heute. Der Tag würde die Farbe tragen, die in Variationen von hell bis dunkel auf Häusern, Straßen, Dächern, Bäumen und Himmel lag: Grau.
Die Schüler standen als eckiges Hufeisen auf dem Hof hinter der Schulmauer. Obwohl es keine fünfzig Meter entfernt stand, war das breithüftige Tor vom Hof aus nicht mehr zu sehen. Die Blicke gingen in Richtung Turnhalle. Links neben der Fahnenstange stand der Direktor, daneben die Klasse 11B, links daneben ein Tisch mit Lautsprecher, links daneben der Sportlehrer, noch nicht im Trainingsanzug, denn der Appell war ein feierlicher Akt. Er trug Bügelfaltenhose mit hellblauem Anorak und hielt die Kabel, die im Eingang der Turnhalle verschwanden. Vor dem Tisch mit dem Lautsprecher standen Männer in Armeeuniformen.
Durch das Mikrophon schallte die Stimme des Direktors: Der Appell ist eröffnet und damit das neue Schulhalbjahr.
Er kam gleich zum Kern des Tages, heute war der erste März, Tag der Nationalen Volksarmee. Deshalb, und das ist schon Tradition an unserer Schule, sagte er, hat das Lehrerkollektiv wieder Angehörige der Nationalen Volksarmee eingeladen, die einmal an unserer Einrichtung Schüler waren. In den nächsten beiden Stunden werden unsere Gäste in die einzelnen Klassen gehen, von ihrer Ausbildung und ihrem Beruf als Offizier erzählen und sich den Fragen der Schüler stellen. Am Nachmittag wird es einzelne Arbeitsgruppen geben, denen je ein Offizier oder ein angehender Offizier vorsteht. Jeder Schüler wird an einer Arbeitsgruppe teilnehmen.
Merles Füße wurden kalt. Sie kannte dieses: Wird teilnehmen. Es gab keine Ausrede, die gut genug war, dem fernzubleiben. Auch wenn man nicht Offizier werden wollte. Um sieben Uhr dreißig begann der Fahnenappell, um elf Uhr dreißig ihr Unterricht. In drei Minuten würden die Schüler gesungen haben: Brüder zur Sonne zur Freiheit. Ein Männerchor würde aus dem Lautsprecher schallen, so war das Singen auf der Straße hinter der Schulmauer laut genug zu hören. In drei Minuten würde Merle wieder nach Hause fahren, denn es lohnte nicht, vier Stunden lang auf ihren Unterricht zu warten. Wieder in der Schule würde sie zwei Stunden halten, die nächsten vier am Nachmittag würden ausfallen für die Arbeitsgemeinschaften der Armeeangehörigen.
Einer der Offiziere war dicker als die anderen. Er nickte Merle zu und lächelte etwas. Sie nickte zurück. Vor fünf Jahren waren sie in eine Klasse gegangen. Der Dicke war nie aufgefallen, er hatte nichts Besonderes, sein Weg in die Armee war seine hervorstechende Eigenschaft. Damit konnte er mehr als drei Dreien auf dem Zeugnis haben am Ende der zehnten Klasse und wurde trotzdem in die elfte übernommen. Schüler mit anderen Berufswünschen mußten so die Schule verlassen.
Der Dicke lächelte. Heute war er Vorbild, ein herausragendes Beispiel. Er stand vorn für diesen Satz: Solche Größen hatte die Schule hervorgebracht.
Was machen Sie am Vormittag?
Fahrenheit stand plötzlich hinter Merle und sprach gleich weiter: Ich habe in der zweiten und dritten Stunde frei, tun Sie mir die Güte an und gehen mit mir einen Kaffee trinken?
Woher wissen Sie ‑
Ich weiß es eben, und Sie wollen doch den Tag der Volksarmee würdig begehen? Erwähnte ich schon, daß ich Sie einlade?
Noch würdiger geht es nicht, sagte Merle.
Sie rührte in der Tasse und war froh, hier zu sitzen. Das Möbelkaufhaus in der Klement-Gottwald-Straße hatte oben, mit langen Stores von den Küchen abgetrennt, ein kleines Café, das war nicht schön, dafür warm, und niemand würde sie hier sehen.
Ich möchte Sie um etwas bitten, sagte Fahrenheit. Ich möchte du sagen, aber Sie müssen einverstanden sein.
Mit allen möglichen Lehrern duzte sich Merle schon. Fahrenheit hatte lange gewartet.
Natürlich. Warum nicht. Du.
Hallo, Merle.
Er sagte es mit einem schräg gehaltenen Kopf und einem blinzelnden Auge. Aber er sagte es sehr weich und mit einer schönen Betonung auf dem M.
Ich bin Albrecht.
Ich weiß.
Ich dachte zuerst, es paßt nicht zu dir, diese Konsequenz, dieses Nichtlebenwollen. Aber eigentlich könnte es jeder tun.
Du warst nett, freundlich, höflich, bis zum Schluß, dabei saß dieser Entschluß längst in deinem Kopf. Um Hilfe hast du nich gebeten, du hast dein Leben beendet irgendwann.
Ich könnte dich verfluchen! Den Dreck einfach anderen zu überlassen! Was soll ich jetzt mit dieser Nachricht! Du gehst mich nichts mehr an. Das wolltest du doch, mich nichts mehr angehen. Immer schön in Reih und Glied bleiben, nicht heraustreten, nicht auffallen, nicht ehrlich sein müssen!
Vielleicht war ich ehrlicher als du, obwohl nicht immer ehrlich. Welches Ich? Ständig war es gespalten in ein äußeres, ein inneres. Fast jeder hatte sein Gesellschafts-Ich und sein Nischen-Ich. Eines war DDR-Bürger, geschult und einheitlich funktionstüchtig als Schablone, das andere leuchtete als Profil mal mehr, meistens weniger durch. Ich suchte jedes Mal sofort nach dem Profil und machte den Fehler, die Schablonen gar nicht mehr zu sehen, weil sie mich langweilten. Ich übersah deren Kanten und stieß mich daran. Ich liebte und verachtete dich gleichzeitig.
Das Vergangene, dachte ich, sei ich los. Ausatmen wollte ich können, durchatmen, neue Menschen sehen, Unbekannte, die nichts mit der alten Zeit zu tun hätten, mit Umriß und Profil aus einer einzigen Linie. Zu ihnen gehörig wollte ich mich fühlen, neutral werden.
Niemals werde ich neutral sein. Ich habe diese Vergangenheit, so wie du sie hattest. Was du nicht mehr hast, ist die Zukunft, die Chance. Ich kann hoffen, daß sie für mich eine Chance ist. Obwohl sie schon Farben hat, Vergangenheitsfarben mit Symbol: Hammer, Zirkel, Ährenkranz auf schwarz, rot, gold.
Bunt, nicht wahr. Ich möchte das nicht tragen müssen.
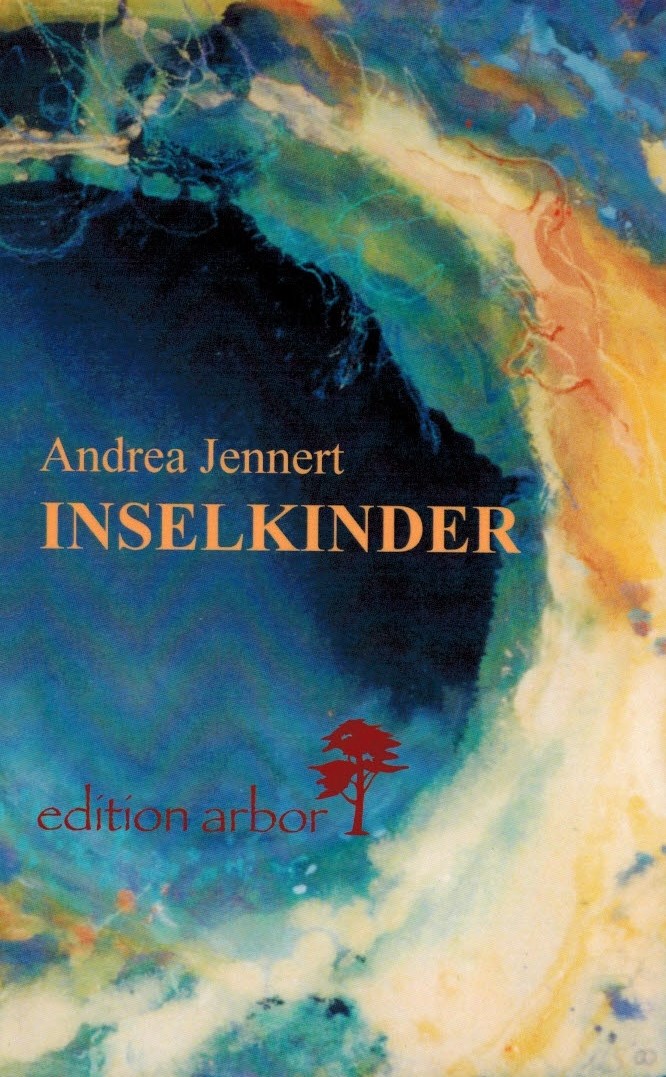
No responses yet